
Richard Drury, GettyImages
Ein gestärkter Dreiklang der Wissenschaftskommunikation
Mit ihrem neuen Förderprogramm möchte die Volkswagenstiftung die weitere Vernetzung von Forschung und Praxis anregen und Raum für kritische Reflexion schaffen. Georg Schütte, Generalsekretär der Stiftung, bespricht die Ziele des Programms und aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation.
Dieser Beitrag erschien am 07. Juli 2020 auf dem Portal Wissenschaftskommunikation.de, das Interview führte Rebecca Winkels. Die studierte Biologin und Wissenschaftsjournalistin ist Leiterin der Strategischen Kommunikation bei Wissenschaft im Dialog und leitet darüber hinaus die Projekte wissenschaftskommunikation.de und Die Debatte (www.die-debatte.org).
Herr Schütte, das neue Programm der Volkswagenstiftung für Wissenschaftskommunikation heißt "Wissenschaftskommunikation hoch drei". Laut der Ausschreibung möchten Sie "Freiräume zur Weiterentwicklung der Wissenschaftskommunikation und ihrer Forschung" schaffen. Wo sehen Sie vor allem Potenzial zur Weiterentwicklung?
Wir konzipieren Wissenschaftskommunikation in unserem Programm "Wissenschaftskommunikation hoch drei" als Dreiecksbeziehung zwischen Wissenschaft, Journalismus und Öffentlichkeit, wobei mit Wissenschaft explizit auch die wissenschaftliche Reflexion über Kommunikationsverhältnisse gemeint ist. Wir wollen also in dem Programm disziplinäre Fachwissenschaften zusammenbringen mit denjenigen, die über die Kommunikation wissenschaftlich reflektieren – also im weitesten Sinne den Kommunikationswissenschaften –, sowie Praktikerinnen und Praktikern. Aus meiner Sicht mangelt es in Deutschland an der Reflexion über Wissenschaftskommunikation in ihren verschiedenen Wirkungs- und Entstehungszusammenhängen.
Wir brauchen ein besseres Verständnis für die Ursachen des Gelingens und Misslingens von Wissenschaftskommunikation. Uns geht es darum, dieses Wissen zum einen zu vermehren und zum anderen den Transfer in die Praxis zu fördern. Da sind uns andere Länder einen Schritt voraus und das wollen wir ändern.
Wie hat sich die Wissenschaftskommunikation denn aus Ihrer Sicht entwickelt?
Sowohl die Kommunikation von Wissenschaft in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche als auch die Anfragen aus anderen Bereichen hinein in die Wissenschaft haben quantitativ und qualitativ zugenommen. Wissenschaft ist von fundamentaler Bedeutung für unser Zusammenleben. Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie sehr die Gesellschaft auf wissenschaftliche Expertise angewiesen ist. Daraus ergeben sich neue diskursive Herausforderungen an die Wissenschaft, die ebenfalls durch die Pandemie deutlicher wurden als bisher.

Dr. Georg Schütte ist seit Januar 2020 Generalsekretär der VolkswagenStiftung und war zuvor Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Was genau meinen Sie mit diesen diskursiven Herausforderungen?
Zunächst einmal geht es dabei natürlich um die Forderung an die Wissenschaft, Erklärungswissen für das Verständnis der Situation bereitzustellen. Diese Forderung ist derzeit lauter und nachhaltiger als sonst und verändert das Verhältnis zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Zumal im nächsten Schritt dieses bereitgestellte Wissen dann im öffentlichen Diskurs hinterfragt und herausgefordert wird. Um diesen Diskurs zu gestalten, muss die Öffentlichkeit ein Verständnis dafür haben, was wissenschaftliches Wissen eigentlich ist und wie es entsteht. Auch dies müssen die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation vermitteln und das ist natürlich herausfordernd.
Parallel dazu verändern sich in der aktuellen Lage die Prozesse und Vorgehensweisen innerhalb des wissenschaftlichen Dialogs. Die Corona-Studien, die derzeit veröffentlicht werden, sind häufig Studien mit kleinen Fallzahlen, die im Preprint veröffentlicht werden, also vor dem Peer-Review. Die Ergebnisse sind damit öffentlich zugänglich, bevor die Studie durch die innerwissenschaftliche Qualitätssicherung gegangen ist. Dies führt zu einem öffentlichen Diskurs zu einem sehr frühen Zeitpunkt, der natürlich dann auch die mediale Berichterstattung prägt.
Inwiefern können die Zentren, die mit der Hilfe der Förderung entstehen sollen, in diesem Prozess eine Rolle spielen?
Wir suchen vor allem nach Zentren, die die drei oben beschriebenen Elemente – Wissenschaft, Kommunikationsforschung und Praxis – zusammenbringen und sich mit kommunikativen Herausforderungen befassen. Diese können unterschiedlicher Natur sein und wir hoffen natürlich, dass sich trotz der Corona-Krise jetzt nicht alle nur mit Problemen im Bereich der Gesundheitskommunikation befassen möchten. Ganz wichtig ist für mich, dass aus den Zentren heraus Anwendungsoptionen für die Praxis entwickelt werden. Darüber hinaus erhoffen wir uns eine kritische Reflexion zu aktuellen Themen der Wissenschaftskommunikation. Wir wollen mit den Zentren institutionelle Orte außerhalb der Akademien schaffen, in denen über moderne Wissenschaftskommunikation diskutiert wird.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaftskommunikationsforschung steht im Fokus der Ausschreibung "Wissenschaftskommunikation hoch drei" der VolkswagenStiftung.
Wieso braucht es diese Orte außerhalb der Akademien?
Akademien sind Thinktanks, die Expertise und Erkenntnisse aus der Wissenschaft kondensieren. Der Vorteil der Zentren liegt aber darin, dass wir diesen Diskurs in das universitäre Umfeld zurückholen und damit mitten ins akademische Leben. Davon erhoffen wir uns eine strukturelle Wirkung, die auch in die Ausbildung von Studierenden hineinwirkt. Wir haben dadurch die Chance, auch von dem Wissen jüngerer Generationen zu profitieren. Das ist in einem Bereich wie der Kommunikation, in dem sich Formate und Mediennutzung so schnell verändern, von besonderer Bedeutung.
Sie haben ja im Rahmen einer online gehaltenen Beratungsveranstaltung schon einmal erste Kontakte zu möglichen Bewerberinnen und Bewerbern erhalten. Wie war Ihr Eindruck von dieser Veranstaltung?
Ich habe den Eindruck, dass das Konzept verstanden, aufgenommen und teilweise auch unterschiedlich ausgelegt wurde, was zu vielen neuen und spannenden Anregungen führen wird. Ich bin daher sehr gespannt auf die Konstellationen, die sich dann am Ende bewerben, und es wird uns sicherlich nicht leicht fallen, die besten auszuwählen.
Die Wissenschaftskommunikation ist in den politischen Fokus gerückt, auch das BMBF hat kürzlich ein Grundsatzpapier zu ihrer Weiterentwicklung verabschiedet. Sie kennen dieses ja sicher gut, da sie bis zum vergangenen Jahr noch im BMBF tätig waren. Wo sehen sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Bestrebungen?
Gerade weil ich bis vor Kurzem noch dort gearbeitet habe, möchte ich keinen direkten, wertenden Vergleich abgeben. Ich sehe aber, dass es auf beiden Seiten ein großes Verständnis für die intensivierte Kommunikationsbeziehung zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik gibt. Ich habe das im BMBF als einen längeren Prozess wahrgenommen, der bereits beim Hightech-Forum begonnen hat. Da hat sich eine Gruppe externer Expertinnen und Experten mit dem Thema Partizipation beschäftigt, also der Öffnung der Wissenschaft für die Mitbestimmung oder Mitgestaltung durch die Öffentlichkeit. Hier wurde bereits erkannt, dass diese Öffnung gefördert und unterstützt werden muss, und zwar strukturell. Die Volkswagenstiftung ist mit den geplanten Zentren in der Lage, strukturell in die Wissenschaft hineinzuwirken. Diese Förderung steht nicht in Konkurrenz zum BMBF, sondern komplementiert sie. Privates und öffentliches Handeln ergänzen sich hier gut, und so sollte es auch sein.
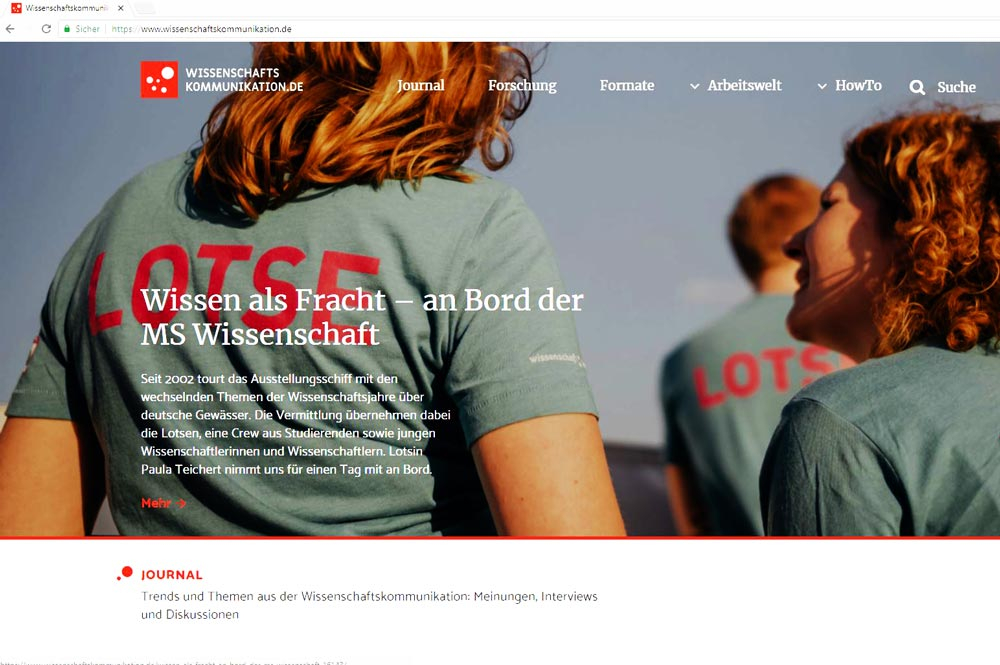
wissenschaftskommunikation.de - hier die Startseite - unterstützt Öffentlichkeitsarbeiter und -arbeiterinnen mit diversen Formaten und Angeboten.
Die Zentren sollen durch den beschriebenen Dreiklang die Wissenschaftskommunikation besser machen. Wieso sind sie überzeugt, dass dieses Zusammenspiel so vielversprechend ist?
Wir glauben, dass das Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven Kreativität freisetzt. Das gilt nicht nur für den Bereich der Wissenschaftskommunikation, aber auch dort. Ich habe vor einigen Jahren in Berlin mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung versucht, klinische Wissenschaft und molekularbiologische Grundlagenforschung zusammenzubringen. Auch hier gab es zuvor in der Zusammenarbeit Defizite und wir haben Bedingungen geschaffen, in denen die unterschiedlichen Akteure zusammenarbeiten mussten und gegenseitig voneinander profitiert haben.
Ich denke, auch im kommunikativen Bereich können wir von einem solchen Ansatz profitieren. Deshalb soll in den Zentren ein beidseitiger Transfer erfolgen: Fragen aus der Praxis sollen in die Wissenschaft gespielt werden, aber eben auch Fragen und Antworten aus der Wissenschaft zurück in die Praxis.
Gehen wir ein wenig weg von den Zentren und hin zur Wissenschaftskommunikation allgemein. In einem FAZ-Artikel haben Sie kürzlich mit Bezug auf die Corona-Pandemie gefordert, dass die Wissenschaftskommunikation sich professionalisieren muss. Was genau fehlt aus Ihrer Sicht trotz der vielen Entwicklungen der letzten Jahre noch?
Im akademischen Kontext meint man mit Professionalisierung die Herausbildung von Berufsfeldern, die sich selbstständig weiterentwickeln und aufstellen. Ein weiteres Element von Professionalisierung ist die akademische Ausbildung. Ich glaube, in diesem Bereich kann sich die Wissenschaftskommunikation noch weiterentwickeln. Wir müssen noch mehr lernen und besser verstehen, was wie wirkt und wie die unterschiedlichen gesellschaftlichen Systeme funktionieren, in die die Wissenschaft hineinwirkt. Das ist ein wichtiger Schritt, um künftig auch mit Krisensituationen noch besser umzugehen.

Die Graphic Novel zum Forschungsprojekt "Europasaurus" wird im Modul "Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer" der VolkswagenStiftung gefördert.
Sind denn durch Corona aus Ihrer Sicht neue Herausforderungen entstanden oder hat die Pandemie nur alte Probleme stärker in den Vordergrund gerückt?
Wenn man das Wissenschaftsbarometer ansieht, erkennt man in der frühen Phase der Pandemie einen starken Zuwachs an Vertrauen in die Wissenschaft, der sich im weiteren Verlauf ein bisschen abgeschwächt hat. Nun ist die spannende Frage: Konsolidiert es sich auf dem höheren Niveau oder nicht? Ich glaube fest daran, dass wir die Wissenschaft für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft brauchen und insofern ist das bisher Erreichte erstmal ein positives Resultat.
In der Krise berufen sich viele Länder – nicht nur Deutschland – darauf, dass ihr Krisenmanagement auf Wissenschaft basiere. Trotzdem gibt es unterschiedliche Lösungsansätze, die zur Bewältigung gewählt werden. Kann das der Wissenschaft schaden?
Ja, natürlich. Hier werden vereinfachte Beziehungen hergestellt. Wissenschaftliches Wissen ist immer Wissen auf Zeit und lässt immer auch andere Herangehensweisen zu. Was in der Pandemie an konkretem Handeln auch von staatlicher Seite passiert, ist eine politische Entscheidung. Sie basiert auf einer Auswahl bestimmter Erklärungsansätze. Und diese Entscheidungen sind mit Risiken verbunden. Ich habe großen Respekt vor den Personen, die aus der Fülle der Optionen und Erkenntnisse eine Auswahlentscheidung treffen müssen. Eine der großen Schwierigkeiten, vor denen wir aktuell stehen, ist ein Kommunikationsparadox: Es ist uns hier in Deutschland gelungen, die Pandemie in den Griff zu bekommen – und schon fragen sich die Leute, ob die Maßnahmen überhaupt notwendig waren. Dafür ist es entscheidend, dass Wissenschaft und Politik transparent agieren und genau erklären, weshalb wie entschieden wurde.
Was genau ist damit am Beispiel der Wissenschaft gemeint?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen erklären, dass es nicht den einen Weg gab, der unter allen Umständen richtig oder falsch gewesen wäre. Die Entscheidung zwischen dem deutschen Ansatz und dem Ansatz der Herdenimmunität, der ja in einigen anderen Ländern, wie beispielsweise Schweden oder anfangs Großbritannien, gewählt wurde, hängt ja von sehr vielen Dingen: den Infektionsverläufen etwa oder der Belastbarkeit des Gesundheitssystems. Deshalb wäre es fatal, wenn am Ende gesagt wird, dass die Wissenschaft den richtigen Weg einfach nicht kannte. Es ist eben komplex, und diese Komplexität verständlich zu machen, ist eine Dauerherausforderung für Wissenschaft und Politik. Gelingt dies nicht, können beide Institutionen Schaden nehmen. Ich glaube, die Chance in der Pandemie besteht darin, dass im öffentlichen Bewusstsein ein neues Verständnis für Wissenschaft und Politik entsteht. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Können Sie ein Beispiel nennen, das diese Hoffnung begründet?
Die Corona-Warn-App ist aus meiner Sicht das beste Beispiel und die Entwicklung erfüllt mich mit großer Freude. Hier wurden die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich des Datenschutzes gehört und ernst genommen. Die Politik hat zugehört, daraus gelernt und gemeinsam mit der Wissenschaft eine App entwickelt, die funktioniert, leicht zugänglich ist und die Bedenken der Kritikerinnen und Kritiker ausgeräumt hat. Hinzu kommt, dass die App zeigt, dass wir in Deutschland technische Entwicklungen vorantreiben können – etwas, woran wir häufig auch selbst zweifeln. Insofern ist diese App ein tolles Beispiel dafür, wie ein gelungener öffentlicher Diskurs zu etwas führen kann, was unterschiedliche Ziele und Interessen kombiniert und dabei seinen Zweck erfüllt.
Wie hat sich die Wissenschaftskommunikation bereits in den letzten Jahren gewandelt und wo sehen Sie noch Baustellen?
Im PUSH-Memorandum vor 25 Jahren ging es noch sehr stark darum, Wissen aus der Wissenschaft in die Gesellschaft zu tragen. Seitdem haben wir viel dazugelernt. Es reicht eben nicht aus, Wissen in die Gesellschaft zu „pushen“, wir müssen in einen beidseitigen Dialog treten – also miteinander sprechen und einander auch zuhören. Das ist eine fundamentale Weiterentwicklung. Wir sehen zudem, dass es in der Wissenschaft mehr Anerkennung für Kommunikation gibt. Hier hat sich viel zum Positiven entwickelt. Gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ein Interesse daran zu lernen, wie man gut und zielgerichtet kommuniziert.
Seit den Anfängen hat sich auch das Mediengefüge massiv verändert und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Diese medialen Umbrüche sind natürlich auch eine große Herausforderung, insbesondere für den Wissenschaftsjournalismus. Auf diese Herausforderungen gibt es keine einfachen Antworten, aber wir müssen sie finden. Gerade deshalb fände ich es spannend, wenn es in unseren Zentren auch Forschende aus der Medienökonomie gäbe. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle für den Wissenschaftsjournalismus und vielleicht können unsere Zentren hierzu einen Impuls geben.
Wenn ich im September – also nach der Entscheidung, welche Zentren den Zuschlag erhalten – anrufe, was würden Sie hoffen, mir im Bezug auf die Zentren sagen zu können? Und was hoffen Sie mir in fünf Jahren zu erzählen?
Ich hoffe Ihnen im September sagen zu können, dass wir drei Zentren ausgewählt haben, die unsere Anforderungen erfüllt und uns zugleich mit weiterführenden Ideen überrascht und überzeugt haben. In fünf Jahren sage ich dann hoffentlich, dass die Antragstellenden vor fünf Jahren eine tolle Idee hatten, aus der sich etwas entwickelt hat – und dass sie gleichzeitig in den fünf Jahren auf viele weitere Ideen gekommen sind und diese ebenfalls weiterverfolgt haben. So dass wir vielleicht sogar das Gefühl haben, die Entscheidung liege schon zehn Jahre zurück. Unterm Strich erhoffe ich mir also als Vertreter der Förderorganisation einen gemeinsamen Lernprozess mit vielen Überraschungen, die schließlich zu positiven Veränderungen führen.

